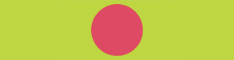|

So vielversprechend Darren Aronofskys Leinwand-Debüt "Pi" auch war - mit einem Nachfolger wie "Requiem for a Dream" konnte man wirklich nicht rechnen. Mehr, als sie aus dieser Literaturverfilmung über Sucht erfahren, brauchen Sie nicht zu wissen.
Seit Amerika seinen großen, blöden und völlig sinnlosen "War Against Drugs" (typisches CNN-Motto) eröffnet hat, kriegt man aus der Propagandazentrale Hollywood kaum noch hedonistische, witzige Drogenfilme geliefert. Eigentlich war "Angst und Schrecken in Las Vegas" (1998) der letzte wirklich erfreuliche Kinostreifen dieser Art - und den hat sowieso keiner verstanden. Und was wir in letzter Zeit vorgesetzt bekamen, konnte auch nicht so recht überzeugen: Stephen Soderberghs langweiliges Schulfernseh-Lehrstück "Traffic" (siehe EVOLVER-Rezension) demonstrierte vor allem, daß Ekelpaket Michael Douglas eine Frau gefunden hat, die zu ihm paßt; und natürlich auch, daß Künstler einfach keine guten Filme machen können. Und Ted Demmes "Blow" (siehe EVOLVER-Rezension) war zwar ganz nett - vor allem wegen Johnny Depp -, hinterließ aber im Endeffekt auch nicht mehr nachhaltigen Eindruck als ein paar schnelle Lines...
Wen ruft man also an, wenn man einen ordentlichen Streifen über Rauschgift- und andere Süchte braucht? Vielleicht jenen Mann, dem es vor drei Jahren mit seinem Debüt "Pi" gelang, Großstadtparanoia, Zahlentheorie und Migräne überzeugender auf Zelluloid zu bannen, als das je einer seiner Kollegen geschafft hat? Genau, es wird höchste Zeit, sich in Sachen anspruchsvoller Kinofilm auf Darren Aronofsky zu verlassen - und weiters auf einen echten Klassiker der Bewegung, nämlich den Schriftsteller Hubert Selby Jr., der mit seinem Roman "Requiem for a Dream" eines der unwiderstehlichsten Bücher zum Thema ablieferte.
Selby und Aronofsky arbeiteten gemeinsam am Drehbuch zu dieser Literaturverfilmung, die sich vor allem mit dem Thema Sucht auseinandersetzt. Drei der vier Protagonisten sind ganz einfach Heroinkonsumenten, in einem New York, das vom irren Bürgermeister Giuliani noch nicht "gesäubert" wurde: Harry Goldfarb (Jared Leto), sein Kumpel Tyrone C. Love (Marlon Wayans) und seine hübsche Freundin Marion (Jennifer Connelly, die seit "Rocketeer" keinen Tag gealtert scheint). Die Laufbahn der drei fängt so an, wie das bei Junkies immer ist - am Anfang ist alles lustig und energiegeladen, die Droge macht Spaß, man findet immer irgendeine aufnahmebereite Vene und lebt im Bewußtsein, ohnehin jederzeit aufhören zu können. Außerdem hoffen Harry und Tyrone, demnächst einen großen Deal durchziehen zu können, der ihnen den abgeschmackten amerikanischen Traum vom großen Geld erfüllen soll.
So gut die drei jungen Darsteller den Abstieg vom Genießer zum total fertigen Wrack auch spielen - sie alle werden von der vierten Hauptperson, Harrys Mutter Sara (Ellen Burstyn) in den Schatten gestellt. Sara lebt alleine, seit der Mann verstorben und der Sohn aus dem Haus ist. Sie hat nichts als ihren Fernsehapparat, in dem sie sich Tag für Tag die Show eines schleimigen Selbsthilfe-Gurus anschaut, und hofft, selbst einmal als Kandidatin eingeladen zu werden. Zu diesem Zwecke will sie aber noch ein paar Kilo abnehmen, und als ihr eine Freundin aus dem Mietshaus von Schlankheitspillen erzählt, läßt sie sich die von einem bereitwilligen Arzt verschreiben. Die Tabletten sind purer Speed, lassen Sara wie einen wahnsinnigen Putzteufel durch die Wohnung rasen, verschaffen ihr nach einiger Zeit Halluzinationen und bringen sie schließlich - und das in einer völlig derangierten schauspielerischen Tour de force - in die Nervenheilanstalt, wo sie mittels "Elektrokrampftherapie" ruhiggestellt wird.
Die Schicksale seiner vier Antihelden, der psychische Zerfall Saras und der Absturz der Jugendlichen in Prostitution, Krankheit, Verstümmelung und Gefängnis werden von Aronofsky nicht mit dem moralischen Zeigefinger erzählt, sondern in seinem seit "Pi" noch weiterentwickelten Stil der "Hip-Hop-Montage", die aus dem Experimentalfilm bekannte Mittel schreiend ins Mainstream-Kino zerrt: Split-Screen-Szenen, Zeitraffer, durchchoreographierte Abstürze in den Wahnsinn, halluzinierte Musical-Szenen, der Einsatz von Farbe als inszenatorisches Werkzeug, schnelle Schnitte, perfekt ausgewählte Musik. Seine Reise vom fröhlichen, hellen "Sommer" (erster Teil) über den "Herbst", als sich bereits deutliche Indizien für die bevorstehende Katastrophe manifestieren, bis in den kahlen, hoffnungslosen "Winter" des letzten Teils, der schonungslos draufhält, als das Leben sämtlicher Protagonisten endgültig zerstört wird (bestenfalls für Tyrone gibt es noch Hoffnung), erspart dem Zuseher aber auch gar nichts. Und das ist gut so - obwohl natürlich, wie immer, zu bezweifeln ist, daß sich potentiell Süchtige selbst von den schlimmsten der gezeigten Szenen davon abhalten lassen werden, es "wenigstens einmal zu probieren".
Andererseits verbirgt sich in diesem psychedelischen Trip des Regisseurs auch eine Menge Humor, der sich auch in den scheinbar schockierendsten Passagen zeigt. Alles in allem ist "Requiem for a Dream" der bisher wohl beste US-Film dieses Jahres; genau aus dem Grund hat sich auch kein Mainstream-Verleih, sondern eine kleine Vertriebsfirma dieses Meisterwerks angenommen. Die anderen haben ohnehin genug damit zu tun, ihre schwachsinnigen Big-Budget-Lügengeschichten unters Volk zu bringen...
Alle 4 Kommentare ansehen
der mit abstand beste film
(hyperventilator, 28.09.2001 16:45)
jaja die drogen
(kidnapster, 04.10.2001 19:47)
Nein, nein, so nicht
(PH, 04.10.2001 20:00)
Re: der mit abstand beste film
(OH, 10.10.2001 03:22)
|

|