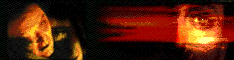Ein guter Film braucht eine gute Story. "Jesus´ Son" - ein episodisches Roadmovie - hat gleich mehrere davon und begeistert sanft mit authentischen, skurrilen Momenten und exzellenten Darstellern: eine gekonnt inszenierte Literaturverfilmung von Newcomerin Alison McLean.
Irgendwo in Iowa, 1971. Hier hängt Slacker Fuckhead (Billy Crudup) mit ein paar seltsamen Typen ab und reist hauptsächlich ziel- und planlos durch die Gegend. Doch dabei stolpert der etwa 24jährige "Drifter in the Dark" von einer merkwürdigen Begebenheit und Begegnung in die andere. Es scheint, als würde er mit traumwandlerischer Sicherheit jede Art von Unglück, größeren und kleineren Katastrophen anziehen und als würden sich seine düsteren Vorahnungen immer bestätigen.
Nur einmal wendet sich das Blatt, als er auf einer Party seiner Traumfrau begegnet. Die leidenschaftliche Affäre mit der heroinabhängigen Michelle (Samantha "Sweet and Lowdown" Morton) endet schnell in einer gemeinsamen Drogensucht. Michelle wird die Liebe seines Lebens, allerdings mit ständigen Unterbrechungen. Zwischen behutsamer Intimität, Streiten, Trennungen und Wieder-Zusammensein verbringen die beiden ihre Tage mit Drogenkonsum und kleineren Diebstählen. Oder Slacker kommt dadurch zu Geld, daß er mit seinem völlig durchgedrehten Freund (Denis Leary) Kabel aus alten Häusern reißt. Als Michelle schwanger wird, wollen beide clean werden. Fuckhead nimmt einen Job im Krankenhaus an, doch der Versuch eines geordneten, verantwortungsvollen Lebens dauert nicht lange. Lieber testet er mit seinem Arbeitskollegen Georgie (Jack Black aus "High Fidelity") den Tablettenvorrat in einer einsamen Waldgegend, begleitet von bizarren Unfällen und Halluzinationen. Doch erst ein richtig tragisches Ereignis reißt den Herumtreiber in ein schwarzes Loch, aus dem er durch eine Rehabilitationsklinik und wundersame Erlebnisse in einem Altenheim und den Gesang einer Mennonitin errettet wird.
Den Inhalt von "Jesus´ Son" wiederzugeben fällt schwer, weil er aus den Erinnerungen des Protagonisten besteht. Und die sind, weil dauernd drogengeschwängert, natürlich bruchstück- und sprunghaft, zwischen Realität und Halluzination angesiedelt. "I think I didn´t finish the story" ist der Leitsatz, der die einzelnen Episoden verbindet. Diese entstammen dem gleichnamigen Kurzgeschichten-Bestseller von Denis Johnson, der auch das Drehbuch schrieb und in einem Cameo mit Messer im Auge in besagtes Spital eingeliefert wird. Trotz der Anhäufung von Dramen - Mord, Unfall, Tod, Überdosen etc. - bleibt der Film immer liebenswert, authentisch und skurril, wird nie moralisierend oder psychologisch-erklärend.
Bravourös und elegant umschifft die 1958 geborene Regisseurin Alison McLean viele Standardsituationen aller bekannten Drogenfilme der letzten Zeit und ersetzt die sattsam gängige Explizität durch inhaltlichen und bildlichen Ideenreichtum. "Jesus´ Son" geht subtil vor und ist zugleich phantastisch leichtfüßig. Dabei ist er aber weder fashionable noch "cool", und niemand möchte so aussehen. Hauptverantwortlich dafür ist die Figur des Fuckhead, einmal kein lebloses Stereotyp: Weder ist er der prototypische Loser, noch Drogenfreak oder bloßes Opfer. Vielmehr schwebt er durch ein ungelebtes Leben, auf der Suche nach Identität, Sinn und - ja, Erlösung; einer exemplarischen Erlösung aller Weirdos und Geeks, die sich nirgends wirklich zurechtfinden. Denen begegnet er reichlich, und sie werden zum Teil von hochkarätigen Schauspielern verkörpert: Dennis Hopper als niedergeschossener Ehemann, Holly Hunter als mehrfache Witwe, Denis Leary und Greg Germann als überforderter Arzt legen echtes Herzblut in ihre Minirollen.
Und da gute Regisseurinnen Mangelware sind, bleibt Alison McLean, die ihren zweiten Langfilm mit privatem Geld in nur 34 Drehtagen realisierte und trotzdem eine eigene Ästhetik und Handschrift entwickelte, nur zu wünschen, daß ihr nächstes Projekt, ein Horrorthriller, Finanziers findet. "Jesus´ Son" ist auf jeden Fall ein erfreulicher, sehenswerter Beitrag aus dem jüngsten US-Independent-Kino, der auch mit einem netten Soundtrack aufwartet: Statt abgedroschener 70er-Hadern steuern weniger bekannte Spät-Sixties-Pop-Perlen die passenden Lyrics zur Drogenpassion bei.