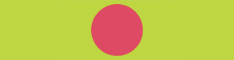Der unbekannte Code, um den es sich im Filmtitel handelt, ist der zur großen Sinnentschlüsselung - vermutlich unserer Existenz und unseres Glücks. Der zum Film hätte schon gereicht... An diesem als "filmisches Rätsel" vermarkteten Haneke-Werk ist nichts rätselhaft, dafür etliches ziemlich platt.
Michael Haneke gibt sich nicht mit Kleinkram ab. Seine Themen sind die großen, vorgeblich relevanten und existentiellen. Als selbsternannter Beobachter gesellschaftlicher Zustände und Klimata widmete er sich hierzulande sehr ausführlich der von ihm konstatierten "emotionalen Vergletscherung" dieses Landes. Das Hauptproblem des Regisseurs: Er verhandelt mit Vorliebe Milieus, die er offenkundig wenig kennt. Weil die etische (also die von außen kommende) Sichtweise anscheinend den analytischen Blick nur noch schärfen kann, wenn man in aufklärerischer Mission unterwegs sind, drehte der Regisseur in Frankreich und Rumänien über französische Zustände und zwar in der dort einschlägigen cineastischen Machart – d. h. Haneke verknüpft lose, in kurzen Sequenzen die Schicksale völlig unterschiedlicher Personen, deren Wege und Handlungen sich immer wieder streifen und kreuzen. Die mosaikartige Montage, die sich nach und nach zu einem Ganzen zusammenfügt, ist zumindest optisch sein erträglichster Film. Inhaltlich stößt man aber bei "Code Unbekannt" des öfteren an gewaltige Grenzen.
Nebeneinander montiert sind Ausschnitte aus dem Berufs- und Alltagsleben einer Schauspielerin, ihres Mannes Georges (Thierry Neuvic), der als Kriegsberichterstatter grauenhafte Fotos aus dem Kosovo-Krieg nach Hause bringt, dann die Schicksale einer schwarzafrikanischen Einwandererfamilie aus Mali, einer Rumänin, die sich als illegale Bettlerin in Paris durchschlagen muß – und weil das noch nicht reicht, wird im Vorbeigehen noch ein wenig das Bauernsterben und die Landflucht thematisiert. Genug ist eben nie genug: Denn es langt nicht, daß etwa die Familie aus Mali arm und rassistischen Anfeindungen ausgesetzt ist; dazu ist die Mutter noch psychosomatisch krank, die jüngste Tochter taubstumm, der älteste Sohn liebt ein weißes Mädchen und der taxifahrende Vater setzt sich in die Heimat ab.
Problematisch wird mit zunehmender Länge dieser sehr gerne "Schlaglichter" genannten Aneinanderreihung zum Teil ausgelutschter Standardszenen die absolute Gleichgewichtung, deren Absicht zwar klar, aber in ihrer Unkommentiertheit fragwürdig ist.
Letztlich geht Haneke auch der Frage nach Realität – gesellschaftlich wie privat – nach, die in einer Zeit der "Reality", wo schon der englische Ausdruck die Distanz sichtbar macht, kaum mehr greifbar zu sein scheint. Und er landet faderweise bei der Antwort "Entfremdung". Denn die zweite Frage, wie man sich angesichts des realen Elends in der Welt und seiner medialen Vermittlung, mit denen man tagtäglich konfrontiert wird, verhalten soll, läßt der Regisseur offen: Er präsentiert alles Abgelutschte, vom Wegschauen und bourgeoisen Diskussionen beim Rotweintrinken bis hin zu bewußter Konfrontation. Und gipfelt in der zweifelhaften Suggestion, daß sich Zivilcourage nicht wirklich bezahlt macht. Die Protagonisten werden zu lethargischen und apathischen Wesen reduziert, die weder die Kunst, noch Liebe und Leidenschaft retten kann.
Bleibt nur noch eine Frage: Sind Menschen wirklich so? Und warum glaubt Haneke, das bloße Zeigen gesellschaftlicher Eiterbeulen sei schon moralisch gut und politisch korrekt? Bei jeder Einsparung von Kommentar und Motivation landen wir bestenfalls bei den Nachrichten, einem halbgaren Dokumentarfilm oder einem beliebigen, als "humanistische Wohltat" getarnten Schmafu. Denn multikulturelles Kindertrommeln für den Frieden kann ja nicht ernsthaft der letzte Ausweg sein.
Zur Zeit liegen noch keine Kommentare vor.
|