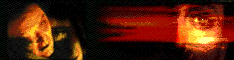Die Biographie des Mathematikers John Forbes Nash Jr. wird zwar als Vorlage für "A Beautiful Mind" gehandelt, aber angesichts der rosaroten Anfärbelung hätte das Genie wohl einen Schizo-Anfall erlitten.
Wer weiß schon, was sich im Gehirn eines Mathematik-Genies abspielt? Noch dazu, wenn es im Laufe seines Lebens von einer fortschreitenden Schizophrenie heimgesucht wird... aber genau darum geht es in Ron Howards neuem Film, der schon im Vorfeld über alle Maßen gelobt wurde - was erfahrungsgemäß Skepsis empfiehlt. Verständnis - echte, tiefe Emphatie - für Geisteskranke zu entfachen, das ist, wie man hört, eines der Ziele dieses Films. Gut, denkt sich der abgebrühte Kinogänger, gehe ich mir halt einen käsetriefenden Kitschbatzen ansehen, schadet auch nichts ab und zu.
John Nash (Russell Crowe) ist ein nervöser Nerd, ein verhaltensauffälliger Jüngling an der Grenze zur Störung, aber auf der Universität von Princeton kann er sich gut behaupten - weil er unsäglich gescheit ist. Der begnadete Zahlenjongleur beeindruckt auch Alicia (Jennifer Conelly), die sich mit dem am Boden seiner Seele reinen und genauso menschlich leidenden Sonderling verliebt. Geheiratet wird bald, weil sich das zu der Zeit gehört hat. Nash gerät in Folge in die Fänge der Cold-War-Maschinerie, was seinem labilen Bewußtsein nicht gerade guttut. Und danach geht es nicht mehr richtig bergauf - Nash wird immer verrückter, verwirrter, vermischt Realität und Einbildung, kennt sich quasi hinten und vorne nicht mehr aus. Seine Frau hat echte Mühe, damit zu leben, und die Krisenphasen verschmelzen schließlich zu einem Leidensweg am Stück. Aber am Ende wird doch alles gut werden, oder?
Ein Genie, das seine eigene Geisteskrankheit zuerst erkennen muß, um sich ihr dann zu stellen und mit ihr leben zu lernen, ohne dabei das gesamte soziale Umfeld zu verscheuchen - ein Stoff, den Hollywood zwar nicht selbst machen, aber ziemlich gut verfilmen kann. Das Leben ist ein langer, harter Kampf, und viele erwarten eben zuviel davon. Zumindest kann man sich nach "A Beautiful Mind" besser fühlen, weil man es letztendlich doch (bisher zumindest) viel leichter hatte. Na, vielleicht auch nicht, aber was soll’s.
Russell Crowe gibt eine Meisterleistung, und seine Partnerin Jennifer Conelly meistert ihre Rolle völlig ebenbürtig. Von ihren Charakter-Darstellungen, um deren gemeinsamen Leidensweg sich der Film dreht, und zu einem kleinen Teil auch von Ed Harris lebt "A Beautiful Mind". Wäre das Schauspiel nicht absolute Spitzenklasse, wäre der Film ein katastrophales Rührstück, geköchelt aus einer Familienpackung Käsedialog. Er ist noch immer reichlich kitschig, aber weil das alles so wahrhaftig wirkt, frißt man es ohne Widerstand.
Wer Lust auf eine geballte Ladung Menschlichkeit hat, ist in "A Beautiful Mind" ziemlich gut aufgehoben - und kann möglicherweise sogar etwas mit hinaus ins Leben nehmen. Daß es hier einige Oscars setzen wird, ist jedenfalls in jeglicher Hinsicht verständlich.