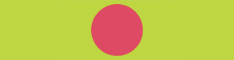Mit einer weiteren Comic-Verfilmung versucht Regisseur Andrew Lau noch einmal die Leinwandmagie zu erzeugen, die ihm mit "Storm Riders" so gut gelungen ist. Doch das Ergebnis kann nicht überzeugen.
Noch vor etwas mehr als einem Jahr sah es so aus, als hätte Regisseur Wai Keung (alias Andy) Lau das Zeug dazu, die Hongkong-Filmindustrie eigenhändig vor dem Niedergang zu bewahren. Sein geniales Schwertkampf & Magie & Action-Epos "Storm Riders" - in bester Tradition der Meisterwerke von Tsui Hark und Ronnie Yu - landete sofort auf Platz eins der asiatischen Kinocharts und konnte sich dort eine ganze Weile halten.
Dementsprechend hoch waren die Erwartungen an den Nachfolger "A Man Called Hero", in dem auch einige der Hauptdarsteller aus "Storm Riders" (Ekin Cheng, Qi Shu und Kristy Yang) mitwirken. Die Story stammt ebenfalls aus einem Comic, mußte jedoch auf Filmlänge gekürzt werden, was ihr sicher nicht gutgetan hat. Erzählt wird die Geschichte des chinesischen Nahkampfmeisters Hero Hua, der sich nach der Ermordung seiner Eltern an irgendwelchen Schergen rächt und daraufhin mit seinem rotglühenden Schwert in Richtung USA verschwinden muß. Seine Liebste, der beste Freund und ein Sohn (von dem er allerdings nichts weiß) bleiben in der Heimat zurück.
16 Jahre später machen sich die so schmählich Verlassenen auf den langen Weg nach Amerika, um Hero zu suchen. Sie landen im New Yorker Chinatown der 20er Jahre und werden dort in einen irrwitzigen und nicht besonders überzeugend geplanten Plot um zwei Kampfschulen, magisch begabte Ninja-Importe aus Japan, ausgebeutete Bergwerksarbeiter und edle Helden verwickelt. Der junge Mann (dargestellt von einem dieser fast schon zu hübschen Canto-Pop-Idole) lernt endlich seinen Papa kennen; der hat aber viel mehr damit zu tun, seinen unglaublich bösen Gegnern absurde Kämpfe zu liefern; dazwischen gibt´s noch ein paar tragische Liebesgeschichten und jede Menge Rückblenden.
Das alles klingt zwar recht erfreulich, ist aber leider fast nie spannend (abgesehen vielleicht von dem absolut überzogenen Showdown auf der Freiheitsstatue, bei dem das halbe Wahrzeichen von den Schwertschwingern abgeholzt wird). Die Chinatown-Kulisse steckt voller Weißer, die des Englischen kaum mächtig sind, dafür aber ordentlich Kung-Fu können; die Spezialeffekte hat man auch schon einmal besser gesehen; die Schauspieler wirken gelangweilt. Nur die Kameraführung entlockt einem beim Zusehen gelegentlich erstaunte Ausrufe - aber das genügt nicht annähernd, um den Film auf "Storm Riders"-Niveau zu bringen. Schade drum.
|