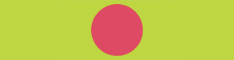Aus dem Polit-Drama "Thirteen Days" über die Kuba-Krise während des Kalten Krieges hätte man sicher eine Stunde unnötigen Gequatsches rausschneiden können. Dann wäre daraus ein anständiger Polit-Thriller geworden.
Wir kennen die Story. Eines Abends stellt das Pentagon fest, daß die Russen strategische Waffen (Atomraketen) mit 1000 Meilen Reichweite auf Kuba installieren. Man ruft einen Krisenstab zusammen. Die Militärs wollen sofort angreifen und Kuba plattwalzen. J. F. K. will jedoch keinen Krieg und befiehlt zuerst eine Seeblockade. Die russischen Schiffe ziehen ab, aber noch sind mehr als 40 Raketen auf Kuba, die da wieder weg müssen. Über komplizierte, teils skurrile Umwege kommuniziert Kennedy mit Chruschtschow und findet schließlich eine friedliche Lösung, obwohl (zumindest im Film) ein amerikanisches Flugzeug über Kuba abgeschossen wurde, wobei ein amerikanischer Bürger zu tödlichem Schaden kam. Das alles ist wirklich passiert.
Nun kommt dieses dankbare Stück US-Geschichte (viel gibt´s davon ja nicht, genau wie von den Indianern) als historisches Polit-Drama ins Kino. Inszeniert hat Routinier Roger Donaldson; Kennedy wird von Bruce Greenwood, sein Bruder Bobby von Steven Culp gespielt, und den persönlichen Berater der beiden gibt Kevin Costner, steif wie eh und je.
Es gibt über diesen Film nicht viel zu sagen, außer vielleicht, daß er auch daran krankt, woran Oliver Stones "Nixon" eingegangen ist: einer Überlänge, verursacht durch staubtrockene Menschelei, die völlig unnötig ist. Das Breitwalzen der persönlichen Probleme und Gedanken der Protagonisten ("Ich wünschte für einen Moment, ein anderer wäre Präsident"; "Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe"; "Wie sag´ ich es bloß meiner Frau und meinen fünf Kindern?") verführen den Zuseher dazu, den eigenen Fingernägeln beim Wachsen zuzusehen. Leider sind auch Schauspiel und Dialoge, selbst in den starken Momenten des Films, ziemlich flach und unverfänglich - offenbar wurde ob des thematischen Ansatzes auch gesamtinhaltlich die harmlose Mitte gesucht.
Es passiert sehr wenig. Wo Donaldson eine Chance sieht, nutzt er sie für schön photographierte Szenen - aber die meiste Zeit sieht man Leute an Verhandlungstischen und Telefonen rumlungern und reden, reden, reden. Das Ende ist dann auch völlig unspektakulär. Daran mangelt es letztendlich auch der Story: Die Realität ist eben nie so aufregend wie Hollywood, und die echte Bedrohung eines Atomkriegs läßt die Leute wohl ziemlich behutsam werden.
Zur Zeit liegen noch keine Kommentare vor.
|