webWoz
Links & Infos

Visionen für geladene Gäste: Mitte Oktober kam Apple-Mitgründer Steve Wozniak auf Einladung der Telekom nach Wien. Gemeinsam mit Ray Kurzweil äußerte er sich über die Verschmelzung von Mensch und Maschine zur "Manchine." 23.10.2010
 Es gibt ein paar Leute, die gern als Erfinder des Personal Computers in die Geschichte eingehen würden. So sehr die Geburt des Digitalzeitalters medial oft um ein paar charismatische Leitfiguren zentriert wird - letztlich steckten hinter den großen Entwicklungen doch Teamwork und das Glück, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Die Eroberung des Neulands begann 1977 mit der Gründung der Apple Computer Company. Der Apple I und II der ehemaligen Garagenfirma waren die ersten kommerziell verwertbaren PCs und zugleich auch die letzten Computer, die von einem einzelnen Ingenieur entwickelt wurden. Der hieß Steve Wozniak und ist neben dem heutigen Apple-Boß Steve Jobs einer der Hauptakteure der frühen PC-Historie.
Es gibt ein paar Leute, die gern als Erfinder des Personal Computers in die Geschichte eingehen würden. So sehr die Geburt des Digitalzeitalters medial oft um ein paar charismatische Leitfiguren zentriert wird - letztlich steckten hinter den großen Entwicklungen doch Teamwork und das Glück, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Die Eroberung des Neulands begann 1977 mit der Gründung der Apple Computer Company. Der Apple I und II der ehemaligen Garagenfirma waren die ersten kommerziell verwertbaren PCs und zugleich auch die letzten Computer, die von einem einzelnen Ingenieur entwickelt wurden. Der hieß Steve Wozniak und ist neben dem heutigen Apple-Boß Steve Jobs einer der Hauptakteure der frühen PC-Historie.
Vergangenen Montag war der Apple-Mitgründer auf Einladung der Telekom Austria Group in Wien zu Gast. Im Straßenbahnmuseum im dritten Bezirk sprach Wozniak über die Verschmelzung von Mensch und Maschine und die daraus resultierenden Folgen: "Manchine. From Mankind to Machine?"
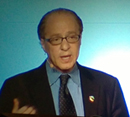 Unterstützt wurde Wozniak durch den Philosophen Ray Kurzweil (rechts im Bild), der mit seinem Vortrag den "future.talk 2010" der Telekom abschloß. Es waren keine Sensationen, die dem geladenen Publikum da präsentiert wurden, sondern Bilder und Visionen kommender Technologien, wie sie auch immer wieder durch die Medien geistern - zum Beispiel Nanobots in der Medizin. Viele der Trends gehören auch zum Standardrepertoire des Linzer "Ars Electronica"-Festivals, dort allerdings in größerer Detailschärfe.
Unterstützt wurde Wozniak durch den Philosophen Ray Kurzweil (rechts im Bild), der mit seinem Vortrag den "future.talk 2010" der Telekom abschloß. Es waren keine Sensationen, die dem geladenen Publikum da präsentiert wurden, sondern Bilder und Visionen kommender Technologien, wie sie auch immer wieder durch die Medien geistern - zum Beispiel Nanobots in der Medizin. Viele der Trends gehören auch zum Standardrepertoire des Linzer "Ars Electronica"-Festivals, dort allerdings in größerer Detailschärfe.
 "In Wahrheit geht es nicht um Geld, sondern ums Glücklich-Sein", gab Steve Wozniak (links) in Wien zu Protokoll. Auf Enthusiasmus komme es an, der Rest würde sich dann quasi von allein ergeben. Grundsätzlich halte er die Förderung des Erfindergeistes von jungen Menschen für das Wichtigste überhaupt. In Anspielung auf das "Manchine"-Thema des Abends sagte Wozniak, er könne sich sogar Roboterlehrer vorstellen: "Stellen Sie sich vor, Sie hätten 30 Lehrer in einer Klasse", denn Schulen "haben nie genug Geld, weil die Kinder keine Wählerstimmen haben". Wozniaks Idee wirkt ein wenig befremdlich und geht über die Leistungsfähigkeit von Lernprogrammen hinaus. Sie erfordert etwas, das die Computertechnik noch nicht kann: Künstliche Intelligenz. Die wird zwar seit Jahrzehnten fast schon flehentlich vorausgesagt - unter anderem auch von Ray Kurzweil -, hat sich aber bislang noch nicht persönlich vorgestellt. Dabei könnte man Wozniaks Grundausrichtung als durchaus pragmatisch bezeichnen: Wenn eine Technologie etwas nützt, dann ist sie gut und sollte verwendet werden. Wenn nicht, dann nicht.
"In Wahrheit geht es nicht um Geld, sondern ums Glücklich-Sein", gab Steve Wozniak (links) in Wien zu Protokoll. Auf Enthusiasmus komme es an, der Rest würde sich dann quasi von allein ergeben. Grundsätzlich halte er die Förderung des Erfindergeistes von jungen Menschen für das Wichtigste überhaupt. In Anspielung auf das "Manchine"-Thema des Abends sagte Wozniak, er könne sich sogar Roboterlehrer vorstellen: "Stellen Sie sich vor, Sie hätten 30 Lehrer in einer Klasse", denn Schulen "haben nie genug Geld, weil die Kinder keine Wählerstimmen haben". Wozniaks Idee wirkt ein wenig befremdlich und geht über die Leistungsfähigkeit von Lernprogrammen hinaus. Sie erfordert etwas, das die Computertechnik noch nicht kann: Künstliche Intelligenz. Die wird zwar seit Jahrzehnten fast schon flehentlich vorausgesagt - unter anderem auch von Ray Kurzweil -, hat sich aber bislang noch nicht persönlich vorgestellt. Dabei könnte man Wozniaks Grundausrichtung als durchaus pragmatisch bezeichnen: Wenn eine Technologie etwas nützt, dann ist sie gut und sollte verwendet werden. Wenn nicht, dann nicht.
Wie die Geschichte des PCs ist auch Wozniaks Geschichte untrennbar mit der von Apple verknüpft. Aus der Garagenfirma von 1976 ist mittlerweile der immer mehr Lifestyle-orientierte Elektronikhersteller Apple Inc. geworden. Wozniak schied 1985 auf eigenen Wunsch aus der Firma aus - und glaubt man der Selbstdarstellung in seinem Buch "iWoz", dann entstand der erste Apple-Computer hauptsächlich aus Spaß und weil Wozniak im "Homebrew Computer Club" damit angeben wollte. Tatsächlich lötete er die ersten Rechner in der Garage der Familie Jobs zusammen. Daß aus dem ursprünglichen Hobby ein recht einträgliches Geschäft wurde - Apple hat soeben einen Quartalsumsatz von 20,34 Mrd. US-Dollar (14,45 Mrd. €) gemeldet - war zwar eine logische Folge, kam aber dennoch "ein bißchen überraschend".
Übrigens: Seit seinem Apple-Ausstieg steht Wozniak, ein bekennender Apple-Fan, immer noch auf der Gehaltsliste des Unternehmens am Infinite Loop im kalifornischen Cupertino. Warum? "Ich habe da eine Wette laufen", sagt Wozniak. "Ich möchte nämlich der am längsten bei Apple beschäftigte Mitarbeiter aller Zeiten werden." Apple-Chef Steve Jobs hat er schon eingeholt - der wurde nämlich 1985 vom damaligen Vorstand gefeuert und erst 1997 wieder zurückgeholt.
 Wenn man es genau betrachtet, dann war Steve Wozniak schon in den 70er Jahren dort, wo Steve Jobs heute zu Hause ist: im Consumer-Bereich. Nach seiner Trennung von Apple erfand er nämlich ein Gerät, ohne das heute kaum ein verkabelter Haushalt überlebensfähig ist: die Universalfernbedienung. Mit der von ihm gegründeten Firma CL9 (für Cloud Nine) vertrieb er die Eigenentwicklung ein paar Jahre lang. Sie war mit einem dualen Mikroprozessor ausgestattet und konnte unter anderem mehrere Geräte, wie etwa Satellitenempfänger, Videorekorder und TV-Gerät, mit einem einzigen Tastendruck in einer gewünschten Konfiguration starten. "Ausgesprochen nützlich, wenn man nicht dauernd mit unzähligen Fernbedienungen hantieren will", kommentiert Wozniak, der offenbar vorausgesehen hat, in welche Richtung sich das amerikanische Fernsehverhalten entwickeln würde.
Wenn man es genau betrachtet, dann war Steve Wozniak schon in den 70er Jahren dort, wo Steve Jobs heute zu Hause ist: im Consumer-Bereich. Nach seiner Trennung von Apple erfand er nämlich ein Gerät, ohne das heute kaum ein verkabelter Haushalt überlebensfähig ist: die Universalfernbedienung. Mit der von ihm gegründeten Firma CL9 (für Cloud Nine) vertrieb er die Eigenentwicklung ein paar Jahre lang. Sie war mit einem dualen Mikroprozessor ausgestattet und konnte unter anderem mehrere Geräte, wie etwa Satellitenempfänger, Videorekorder und TV-Gerät, mit einem einzigen Tastendruck in einer gewünschten Konfiguration starten. "Ausgesprochen nützlich, wenn man nicht dauernd mit unzähligen Fernbedienungen hantieren will", kommentiert Wozniak, der offenbar vorausgesehen hat, in welche Richtung sich das amerikanische Fernsehverhalten entwickeln würde.
Wie die Fernbedienung zeigt, sind Steve Wozniaks Technologievisionen nicht unbedingt computerzentriert. Seiner Meinung nach ginge die Entwicklung in eine Richtung, die "den Umgang mit Technik grundlegend verändert", sagt er. Technik wird in diesem Zukunftsmodell weniger als Werkzeug denn als "Freund" gesehen, als etwas, das Teil der individuellen Lebensweise einer Person wird. Als Beispiel auf dem Weg dorthin nennt Wozniak den Touchscreen, der die Bedienung von Computern langfristig grundlegend verändern wird. "Das bemerkt man schon an den Tablet-Rechnern, die es heute gibt", sagt Wozniak, der über das Haptische hinaus große Erwartungen in Spracherkennungstechnologien setzt. "Das wird ein großer Durchbruch sein." Dann werden Computer vielleicht wie das Holodeck auf der Enterprise auf Zuruf reagieren. Man könnte dann einfach sagen: "Programm einfrieren", und Steve Wozniak, der eben noch mit ausgebreiteten Armen ein Bild der Zukunft zeichnet, würde das Wort im Hals stecken bleiben.
 Der durch das Thema "Manchine" vorgegebene und eigentlich hohe Anspruch des "future.talk" kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich genaugenommen um eine Image-Veranstaltung der Telekom Austria Group handelt. Die Veranstaltungsreihe, die vor geladenen Gästen an ausgefallenen Locations stattfindet, dient dem medialen Bad in der Menge. Der Nutzwert fürs Volk ist eher klein, vor allem, wenn es keine APA-Meldungen liest. Dafür wird Telekom-Chef Hannes Ametsreiter (links im Bild mit Steve Wozniak) wie sein Vorgänger Boris Nemsic immer mehr selbst zum Medienereignis umfunktioniert. Wenn eine Studie über die Technologieakzeptanz der Alpenrepublik vorgestellt wird, hat er sie mitfinanziert. Wenn über die Zukunft diskutiert wird, sitzt er mit am Tisch. Und wenn Mark Zuckerberg Wien besucht, ist er sein bester Freund. Daß Wozniak und Kurzweil am Ende ein bißchen wie Statisten dastehen, liegt an der Beschaffenheit des Events selber. Beide sind leider eher Dozenten als große Redner; dem Thema hätte mehr Öffentlichkeit dennoch nicht geschadet.
Der durch das Thema "Manchine" vorgegebene und eigentlich hohe Anspruch des "future.talk" kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich genaugenommen um eine Image-Veranstaltung der Telekom Austria Group handelt. Die Veranstaltungsreihe, die vor geladenen Gästen an ausgefallenen Locations stattfindet, dient dem medialen Bad in der Menge. Der Nutzwert fürs Volk ist eher klein, vor allem, wenn es keine APA-Meldungen liest. Dafür wird Telekom-Chef Hannes Ametsreiter (links im Bild mit Steve Wozniak) wie sein Vorgänger Boris Nemsic immer mehr selbst zum Medienereignis umfunktioniert. Wenn eine Studie über die Technologieakzeptanz der Alpenrepublik vorgestellt wird, hat er sie mitfinanziert. Wenn über die Zukunft diskutiert wird, sitzt er mit am Tisch. Und wenn Mark Zuckerberg Wien besucht, ist er sein bester Freund. Daß Wozniak und Kurzweil am Ende ein bißchen wie Statisten dastehen, liegt an der Beschaffenheit des Events selber. Beide sind leider eher Dozenten als große Redner; dem Thema hätte mehr Öffentlichkeit dennoch nicht geschadet.
Was Steve Wozniak im Laufe des Abends sagt, scheint im "Seitenblicke"- Blitzlichtgewitter nicht wichtig zu sein. Für Interesse sorgt allein seine Person - und die war einigen anwesenden Redakteuren zwei Stunden vorher offenbar noch nicht bekannt. Ideen kann auch Dominic Heinzl nicht vor die Kamera zerren - geduldige Menschen, wie "Woz" offenbar einer ist, hingegen schon.
Bei der kollektiven Nikotinaufnahme vor der Remise habe ich mich gefragt, was die Mehrheit der Gäste des "future.talk" mit nach Hause nehmen würde: den Geschmack eines hervorragenden Buffets mit einer Maronicreme zum Niederknien oder eine Frage: Wie, zum Teufel, schmeckt ein Manchino?
Der "future.talk 2010" der Telekom Austria Group fand am 18. Oktober 2010 im Wiener Straßenbahnmuseum in der Remise Erdberg statt.
© der Photos: Chris Haderer.
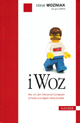
Steve Wozniak: iWoz
Hanser Wirtschaft (2006)
von Steve Wozniak und Gina Smith. Eine interessant und spannend geschriebene Autobiographie, die auf unkomplizierte Art und Weise die Erfindung des PC-Zeitalters nacherzählt. Erfrischend untechnisch, allerdings doch sehr bemüht, den Gutmenschen in den Vordergrund zu rücken.
Im Internet sind die Lauscher immer und überall. Digitale Selbstverteidigung ist angesagt. Die notwendigen Tips gibt Steffan Heuer in seinem Buch "Mich kriegt ihr nicht!"
Big Data und Social Media halten zusammen wie Pech und Schwefel. Ihnen verdankt Barack Obama seine zweite US-Präsidentschaft.
Zum zweiten Mal hat Regisseur J. J. Abrams den Motor der "Enterprise" angeworfen und sie auf eine für den Titel "Into Darkness" eigentlich recht gut ausgeleuchtete Reise geschickt. Chris Haderer ist eine Runde mitgeflogen.
Vom 8. bis 15. Februar geht das "Festival des gescheiterten Films" in den Breitenseer Lichtspielen vor Anker. Gezeigt werden Filme, für die es leider keinen kommerziellen Markt zu geben scheint.
Am 25. Oktober werden im Wiener Rabenhof die 14. "Big Brother Awards" verliehen. Traditionell finden sich unter den Nominierten illustre Namen von Beatrix Karl bis Marie Vassilakou.
Regisseur Julian Roman Pölsler hat sich an der Verfilmung von Marlen Haushofers "Die Wand" versucht - und ein schön photographiertes Hörbuch abgeliefert.
Kommentare_