Aliens: Colonial Marines
ØØØ
(Sega)
erhältlich für: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U

Die "Alien"-Serie ist eine der populärsten Filmreihen der Kinogeschichte. Nach Jahren der Planung erschien nun ein neues Konsolenspiel, das die Ereignisse von James Camerons "Aliens - Die Rückkehr" weitererzählt. Die Folge sind einige Logiklöcher, doch den Zorn der Fans zog eher das Gameplay auf sich. 25.02.2013
Für viele "Alien"-Fans war der 1986 erschienene "Aliens - Die Rückkehr" eine Fortsetzung auf Augenhöhe mit Ridley Scotts SF-Meisterk von 1979. Dagegen wurde David Finchers Debütfilm "Aliens³" im Jahr 1992 eher verhalten aufgenommen. Das lag auch daran, daß unter anderem Michael Biehns Figur des Corporal Hicks abseits des Bildschirms getötet wurde. Nun schickt sich Sega jedoch mit "Aliens: Colonial Marines" an, Geschichte neu zu schreiben - speziell die zwischen "Aliens" und "Alien³".
Statt Applaus erntete man jedoch beinahe unisono Buh-Rufe aus der Blogosphäre. Enttäuschung brach sich Bahn ob der Story-Widersprüche mit dem bisherigen Franchise, der altbackenen Graphik des Spiels selbst und der Tatsache, daß das fertige Produkt, das sich für stolze 50 Euro im Handel erstehen läßt, nicht wirklich der Demoversion des Spiels entspricht. Die Kritik ist natürlich berechtigt, aber auch etwas zu scharf.
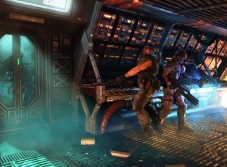 Die Handlung von "Colonial Marines" setzt 17 Wochen nach den Ereignissen aus "Aliens - Die Rückkehr" ein. Die USS Sephora erreicht ein Notrufsignal von Hicks; als sie dem nachgeht, stößt sie auf das Raumschiff Sulaco im Orbit von LV-426. Der Spieler steuert in diesem Ego-Shooter einen Corporal namens Winter und muß es - natürlich unterstützt von Kampfgefährten - nicht nur mit einer Masse an Aliens aufnehmen, sondern wider Erwarten auch mit anderen Marines.
Die Handlung von "Colonial Marines" setzt 17 Wochen nach den Ereignissen aus "Aliens - Die Rückkehr" ein. Die USS Sephora erreicht ein Notrufsignal von Hicks; als sie dem nachgeht, stößt sie auf das Raumschiff Sulaco im Orbit von LV-426. Der Spieler steuert in diesem Ego-Shooter einen Corporal namens Winter und muß es - natürlich unterstützt von Kampfgefährten - nicht nur mit einer Masse an Aliens aufnehmen, sondern wider Erwarten auch mit anderen Marines.
In elf Missionen gilt es, Soldaten der eigenen Einheit beim Überleben zu helfen und einen gefangenen Marine aus den Einrichtungen von Weyland-Yutani auf LV-426 zu befreien. Diese Aufgaben führen nach den Erlebnissen auf der Sephora und Sulaco an bekannte Orte wie die nun verwaiste Kolonie Hadley´s Hope aus "Aliens", auf die Oberfläche von LV-426 sowie ins Raumschiff des Space Jockeys aus "Alien".
Aufgrund dieser nostalgischen Schauwerte gerät das Spiel nun in gefährliches Logik-Fahrwasser. Obwohl am Ende von Camerons Film eine Atombombe gezündet wurde, zeigen sich hier nicht nur die Aliens - vermutlich auch dank Zutun von Weyland-Yutani - putzmunter, sondern Hadley´s Hope wirkt auch noch erstaunlich intakt. Hier und da hängen Kabel von der Decke oder fehlen Elemente der Fassade, dennoch ist die Einrichtung gut in Schuß.
 Hardcore-"Alien"-Fans werden also an dem Setting zu knabbern haben, nicht zuletzt, da es einen Subplot um Michael Biehns Figur gibt, der wenig sinnvoll erscheint. Ungeachtet der unstimmigen Harmonie mit dem Franchise ist "Colonial Marines" jedoch ein solider Alien-Ego-Shooter, dem man nicht zwingend vorwerfen sollte, sich handlungstechnisch an die "Alien"-Reihe anzuschließen. Sowieso zählt die Reihe nicht gerade zu den inhaltlich plausibelsten.
Hardcore-"Alien"-Fans werden also an dem Setting zu knabbern haben, nicht zuletzt, da es einen Subplot um Michael Biehns Figur gibt, der wenig sinnvoll erscheint. Ungeachtet der unstimmigen Harmonie mit dem Franchise ist "Colonial Marines" jedoch ein solider Alien-Ego-Shooter, dem man nicht zwingend vorwerfen sollte, sich handlungstechnisch an die "Alien"-Reihe anzuschließen. Sowieso zählt die Reihe nicht gerade zu den inhaltlich plausibelsten.
Fortan schießt man also mit Dauerfeuer um sich, den Bewegungsmelder immer im Anschlag und stets auf der Suche nach neuer Munition. Wie sich zeigt, sind die Pistolen im Revers nämlich recht nutzlos gegen die Vielzahl an Gegnern, sodaß die Shotgun bald zum treuesten Begleiter wird. Daß sich manche der Aliens dann mit einem simplen Schuß niederstrecken lassen, während andere sich weitaus resistenter zeigen, läßt auf der Hut bleiben.
Obwohl der Xenomorph einst als perfekter Organismus eingeführt wurde, wird er hier klar entmystifiziert. Die Aliens sind nunmehr einfach außerirdisches Viehzeug, ein oft nicht abebbender Strom wuselnder Schwärze, die verhaltenstechnisch eher an die Bugs aus "Starship Troopers" erinnern als an die kalkulierenden Monster der vorangegangenen Kinofilme von Ridley Scott und James Cameron.
 Weniger wäre hier wohl - zumindest für die hartgesottenen Fans - sprichwörtlich mehr gewesen. Wer es jedoch etwas laxer mit dem "Alien"-Kanon und der Darstellung von Hicks und den Xenomorphen hält, wird sich an "Colonial Marines" nicht stören; ebensowenig an dem simpel gehaltenen Gameplay und dem kurzweiligen Plot, der sich an einem verregneten Sonntag in wenigen Stunden durchspielen läßt - auch wenn das sicher keine 50 Euro rechtfertigt ...
Weniger wäre hier wohl - zumindest für die hartgesottenen Fans - sprichwörtlich mehr gewesen. Wer es jedoch etwas laxer mit dem "Alien"-Kanon und der Darstellung von Hicks und den Xenomorphen hält, wird sich an "Colonial Marines" nicht stören; ebensowenig an dem simpel gehaltenen Gameplay und dem kurzweiligen Plot, der sich an einem verregneten Sonntag in wenigen Stunden durchspielen läßt - auch wenn das sicher keine 50 Euro rechtfertigt ...
Das Spiel selbst ist somit ein zweischneidiges Schwert. Die Graphik ist in der Tat nicht state of the art, ohne aber deswegen gleich miserabel zu sein. Insgesamt schadet es "Colonial Marines" vermutlich, daß es den Zusatz "Aliens" trägt und sich damit Erwartungen (und Hoffnungen) aufbürdet, denen es dann - soviel Zugeständnis muß sein - nicht gerecht werden kann. Ein Teil des allgemeinen Ärgers dürfte auch an den Unterschieden zwischen fertigem Spiel und Demoversion liegen.
Letztere scheint optisch wie vom Gameplay her eigens zu Vermarktungszwecken konzipiert worden zu sein, ist in beiden Fällen jedenfalls dem finalen Spiel überlegen und so mitverantwortlich für dessen schwache Rezeption. "Aliens: Colonial Marines" wäre garantiert ein besseres Spiel, wenn es mehr dem Demo entspräche. Ungeachtet der etwas veralteten Graphik, des simplen Gameplays und der nostalgischen, aber unausgegorenen Handlung ist es jedoch ein solides Game für zwischendurch geworden. Mehr aber auch nicht.

Aliens: Colonial Marines
ØØØ
(Sega)
erhältlich für: PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U
Jim Jarmusch machte zuletzt Vampire zu Rockstars und Busfahrer zu Dichtern. In seinem jüngsten Film "The Dead Don´t Die" finden sich Kleinstadtpolizisten infolge einer Klimakatastrophe plötzlich in der Zombie-Apokalypse wieder. Das Ergebnis ist erwartungsgemäß so skurril wie schrullig und verquickt dabei geschickt klassische Zombie-Tropen mit Meta-Momenten und bissiger Persiflage auf die amerikanische Rechte.
Willst du groß und stark werden, dann mußt du ordentlich Fleisch zu dir nehmen. Diesem Glauben hängen vor allem Männer gern nach - so auch der britische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer James Wilks. Zumindest so lange, bis er sich nach einer Verletzung schlau machte und entdeckte, daß viele erfolgreiche Athleten vegane Ernährung bevorzugen, um mehr Leistung bringen zu können. Oscar-Gewinner Louie Psihoyos dokumentiert diese Erkenntnis in seinem Netflix-Film "The Game Changers".
Mehr als 50 Jahre ist es her, daß George A. Romero in "Night of the Living Dead" Zombies als reanimierte Kannibalen salonfähig machte. Seither treiben die Untoten munter ihr Unwesen, sei es im Schnee ("Dead Snow"), im Zug ("Train to Busan") oder beim Schulball ("Dance of the Dead"). Umso beachtlicher, daß Ueda Shin’ichirō in seiner No-Budget-Komödie "One Cut of the Dead" dem Genre dennoch etwas Originelles abgewinnt.
Der Tenor nach Terrence Malicks jüngstem Werk fiel aus wie immer: Der Auteur präsentiere stets dasselbe - ähnlich wie die Kritik an seinen Werken, die sich in Witzeleien über gehauchte Erzählstimmen, an Parfümwerbung erinnernde Kameraarbeit und das Frohlocken in den Feldern erschöpft. Sein neuer Film wird ihm kaum neue Anhänger bescheren, liefert Fans aber das, was sie an ihm schätzen.
Kleine Dinge können eine große Wirkung haben. Das veranschaulicht auch Regisseur Hong Sang-soo in seinem jüngsten Film. Der beginnt nach der Hälfte seiner Laufzeit einfach nochmal von vorne - mit einigen Abweichungen, die der Geschichte eine neue Wendung geben. Das Ergebnis daraus: ein vergnüglicher Doppel-Film über den Moment des Augenblicks.
Vor 17 Jahren avancierte der sehr preisgünstige Found-Footage-Horror "Blair Witch Project" zum Kassenschlager im Kino. Dennoch folgte auf den Indie-Hit lediglich eine einzige Fortsetzung, die den Erfolg nicht wiederholen konnte. Nun bringt Regisseur Adam Wingard die Kameras und den Schrecken zurück in den Black Hills Forest - und das durchaus überzeugend.
Kommentare_